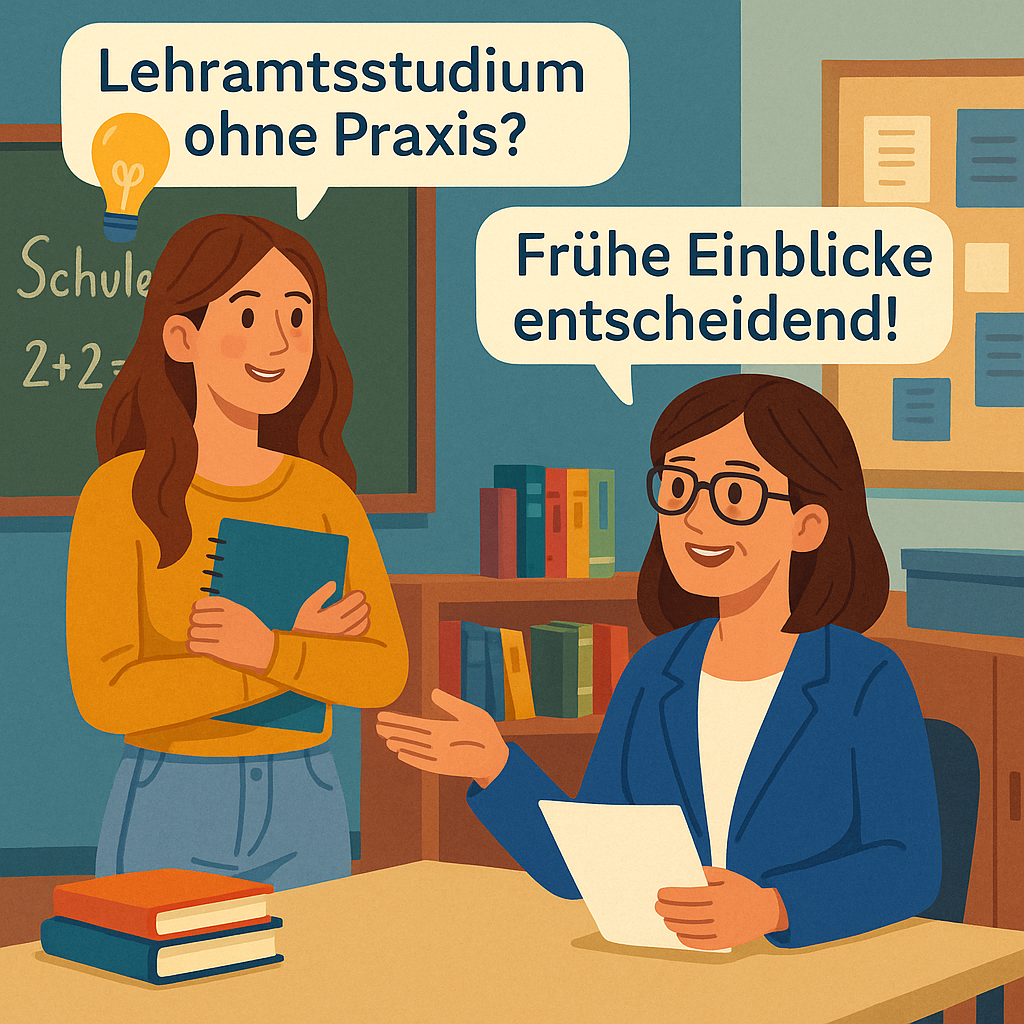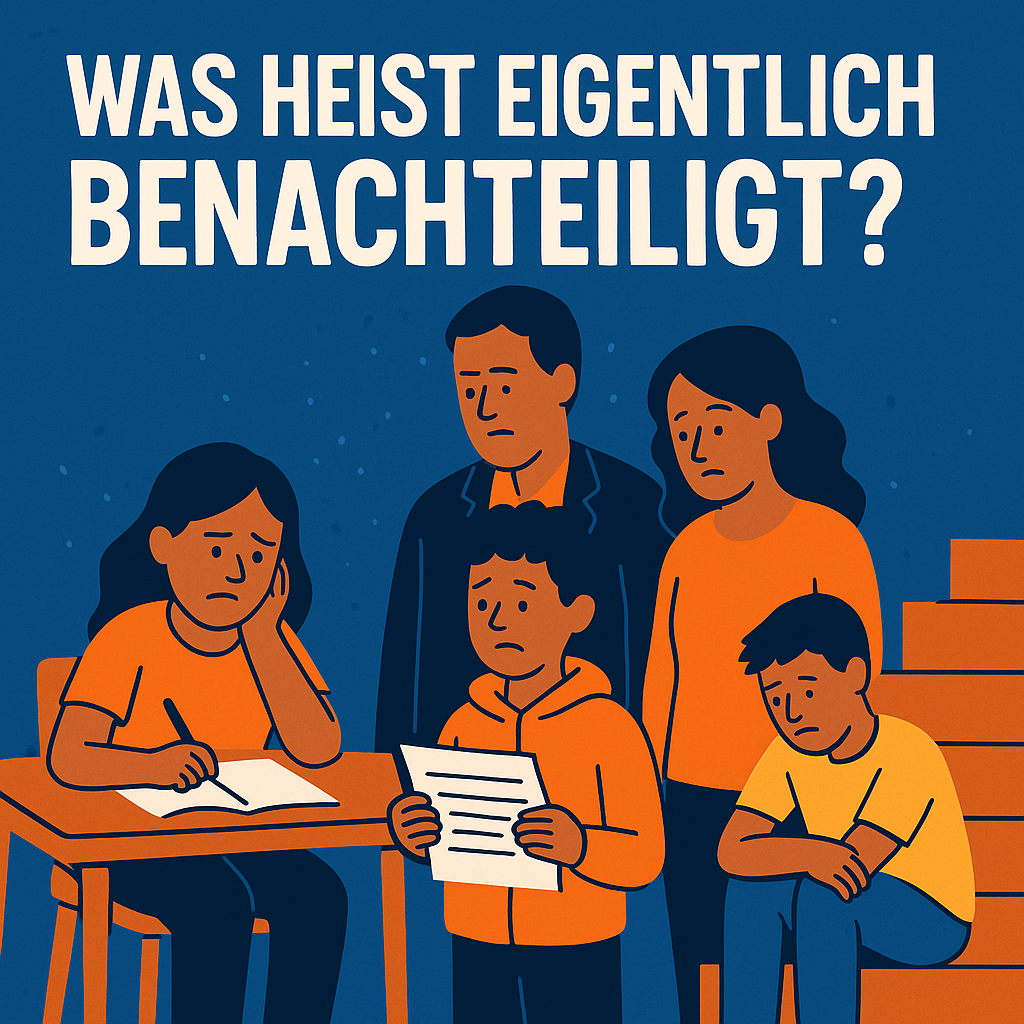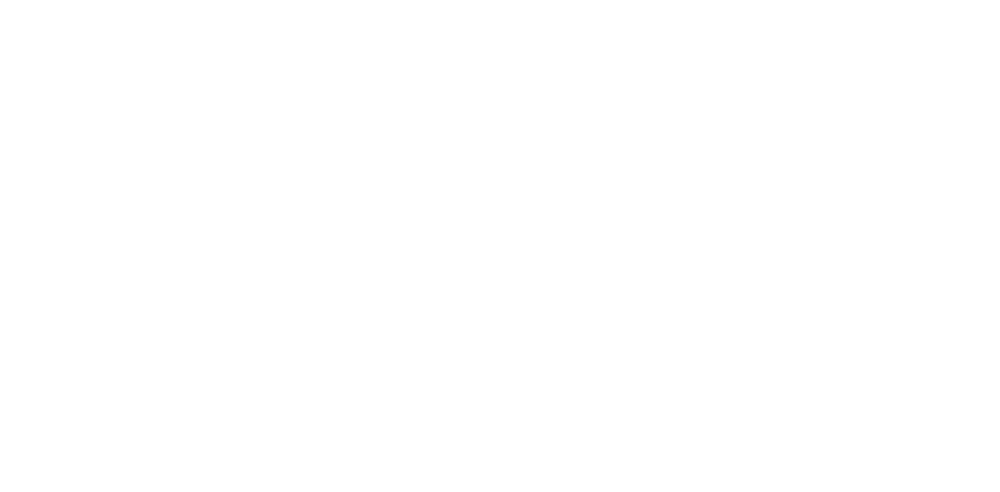Eine Annäherung aus der Dortmunder Schulpraxis
Stell dir vor:
Du bist acht Jahre alt. Vor 1,5 Jahren bist du mit deiner Mutter und deinen Geschwistern aus einem Kriegsgebiet nach Dortmund geflüchtet. Seit fast einem Jahr lebt ihr in einer Unterkunft mit anderen Familien. Du sprichst kein Wort Deutsch. Einen Schulplatz hast du nicht. Du wartest. Tag für Tag. Während andere Kinder lesen, rechnen und Freundschaften schließen, sitzt du im Wartezimmer des Systems. Niemand erklärt dir, wann du endlich dazugehörst. Doch eins ist sicher: Sobald du „dazu gehörst“, musst du mindestens doppelt so viel leisten, um mit den schulischen Herausforderungen zurecht zu kommen.
Oder stell dir vor:
Du bist in der dritten Klasse. Zuhause gibt es keine Bücher, keinen Tisch zum Arbeiten, keine Zeit für Erklärungen. Deine Eltern möchten helfen, aber sie verstehen selbst kaum, was in den Hausaufgaben steht. Die Lehrkraft gibt dir Rückmeldung: „Du musst mehr üben.“ Doch wie? Mit wem? Wo?
Während andere Kinder nachmittags Hausaufgaben erledigen oder draußen spielen, begleitest du am Nachmittag deine Eltern zum Jobcenter. Du übersetzt für sie Gespräche über Fristen, Anträge und Sanktionen. Du verstehst vieles nicht richtig, aber es liegt an dir. Denn sonst ist niemand da, der hilft.
Oder stell dir vor:
Du bist 16. Du hast deine gesamte Schulzeit als Frustration erlebt. Nie hast du dich zugehörig gefühlt. Deine Familie konnte dich nicht unterstützen; weder mit Sprache noch mit Orientierung oder Vertrauen in deinen Weg. Du warst immer auf dich allein gestellt, hast dich durch Unterricht geschleppt, Aufgaben selten verstanden, Rückmeldungen als Demütigung empfunden. Keine AGs, keine Nachhilfe, kein Ferienprogramm. Jetzt stehst du ohne Schulabschluss da. Bewerbungsschreiben? Lebenslauf? Du weißt nicht, wie das geht. Du fühlst dich zu spät. Und irgendwie vergessen.
Diese Szenen sind keine Ausnahmen. Sie sind Alltag an Schulen mit hohem Sozialindex. Auch in Dortmund. Sie machen deutlich: Soziale Benachteiligung ist kein Etikett, sondern eine Erfahrung. Eine, die Kinder früh prägt und ihr Lernen über Jahre beeinflusst.
1. Was bedeutet Benachteiligung in Dortmund konkret?
In Stadtteilen wie der Nordstadt, Westerfilde, Scharnhorst oder Huckarde besuchen viele Kinder Einrichtungen mit extrem hoher Belastung:
- Manche Kinder erhalten erst mit sechs Jahren Zugang zu institutioneller Bildung, weil sie keinen Kitaplatz bekommen haben. Einige Kinder warten jahrelang auf einen Schulplatz und werden erst im fortgeschrittenen Alter – teils ohne jegliche Deutschkenntnisse – eingeschult.
- Viele wachsen in Haushalten ohne deutschen Wortschatz auf und erleben Sprachförderung erst in der Schule.
- Eltern können sich keine Nachhilfe, Musikschule oder Ferienbetreuung leisten. Selbst Busfahrten zum Sportverein sind manchmal zu teuer.
- Kinder erleben wenig Struktur, unregelmäßige Mahlzeiten und Spannungen im familiären Umfeld.
Diese Kinder starten nicht bei null, sondern unterhalb der Startlinie. Und sie wissen es.
2. Wie wirkt sich das auf den Schulalltag aus?
Kinder, die wenig unterstützt werden, zeigen nicht automatisch „schlechtes Benehmen“. Aber sie reagieren auf eine Überforderung, die sie kaum benennen können:
- Sie ziehen sich zurück oder werden laut.
- Sie können sich nicht konzentrieren, weil sie morgens ohne Frühstück gekommen sind.
- Sie vermeiden Beteiligung, weil sie Angst haben, zu versagen oder ausgelacht zu werden.
- Sie wirken älter, weil sie zu Hause Verantwortung übernehmen müssen, die ihnen nicht zusteht.
- Sie bleiben dem Unterricht fern oder erscheinen unregelmäßig (Schulabsentismus), weil es zu Hause niemanden gibt, der ihre Anwesenheit einfordert.
- Sie geraten in soziale Konflikte mit Mitschüler*innen, weil ihnen soziale Codes, Sprache oder Impulskontrolle fehlen.
- Sie leben in einem ständigen Spannungsfeld zwischen schulischen Anforderungen und privaten Belastungen.
Wenn diese Kinder scheitern, dann oft nicht am Stoff, sondern an den Bedingungen, unter denen sie lernen müssen.
3. Warum sind reine Kennzahlen nicht genug?
Ein Sozialindex sagt wenig über das einzelne Kind. Er liefert Hinweise, aber keine Geschichten. Wer benachteiligte Kinder fördern will, muss ihre Lebenswelt kennen:
- Warum hat das Kind keine Hausaufgaben gemacht?
- Warum spricht es im Unterricht nicht?
- Warum wirkt es so müde, still oder ängstlich?
Diese Fragen erfordern Empathie, Zeit und Teamarbeit.
4. Was heißt das für die Praxis?
Förderung darf nicht erst dann beginnen, wenn „Defizite“ festgestellt wurden. Sie muss früh, präventiv und ressourcenorientiert ansetzen:
- Sprachförderung schon vor dem Schuleintritt
- Beziehungsaufbau als Bildungsbasis
- Zugang zu kulturellen und sportlichen Angeboten für alle
- Aufwertung und Ausbau multiprofessioneller Teams
5. Ein Blickwechsel, der Mut macht
Benachteiligung darf nicht als Makel verstanden werden, sondern als Hinweis: Hier braucht ein Kind mehr Aufmerksamkeit, mehr Raum, mehr Unterstützung.
Das Startchancen-Programm bietet die Gelegenheit, Strukturen neu zu denken. Doch dafür braucht es mehr als Zahlen. Es braucht Geschichten. Begegnung. Und die Bereitschaft, über die eigene Komfortzone hinauszudenken.
Denn Bildungsgerechtigkeit entsteht dort, wo wir die Realität der Kinder ernst nehmen. Nicht abstrakt. Sondern konkret. Jeden Tag neu.