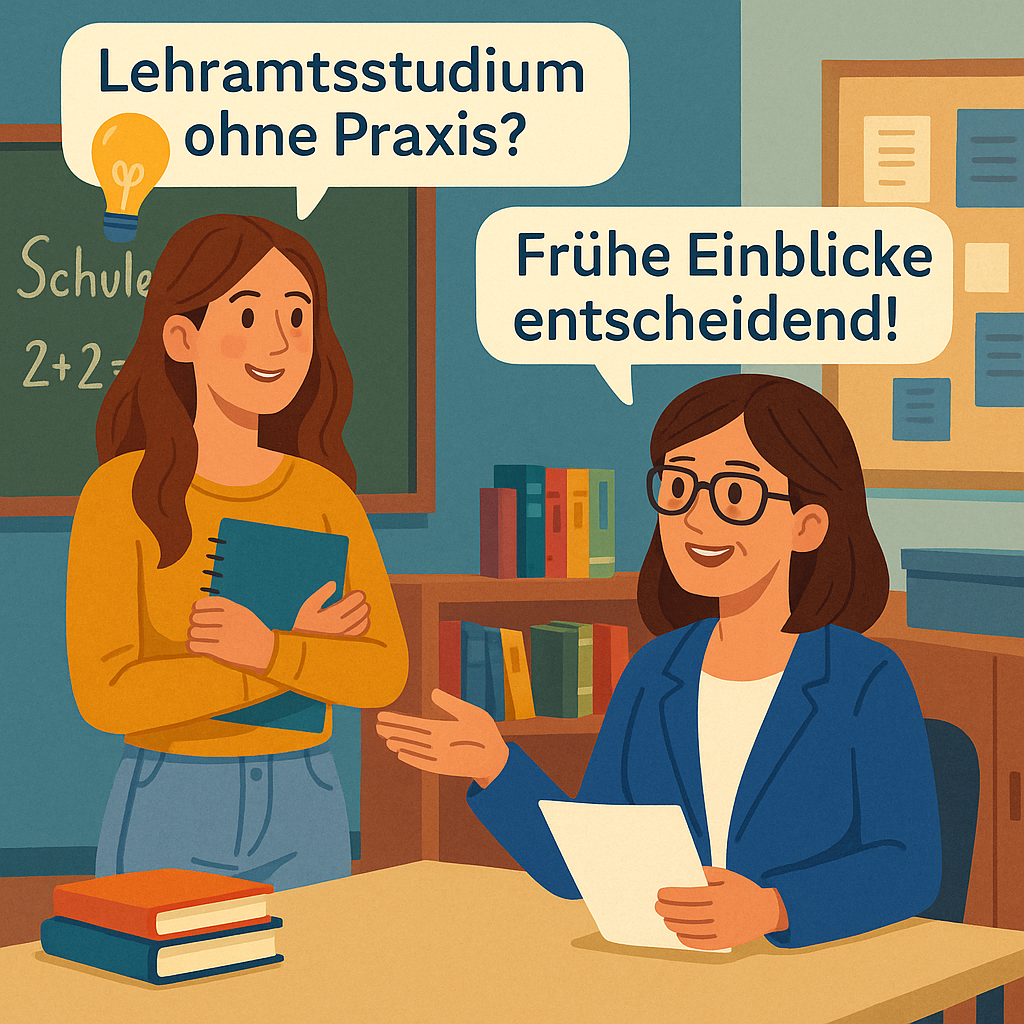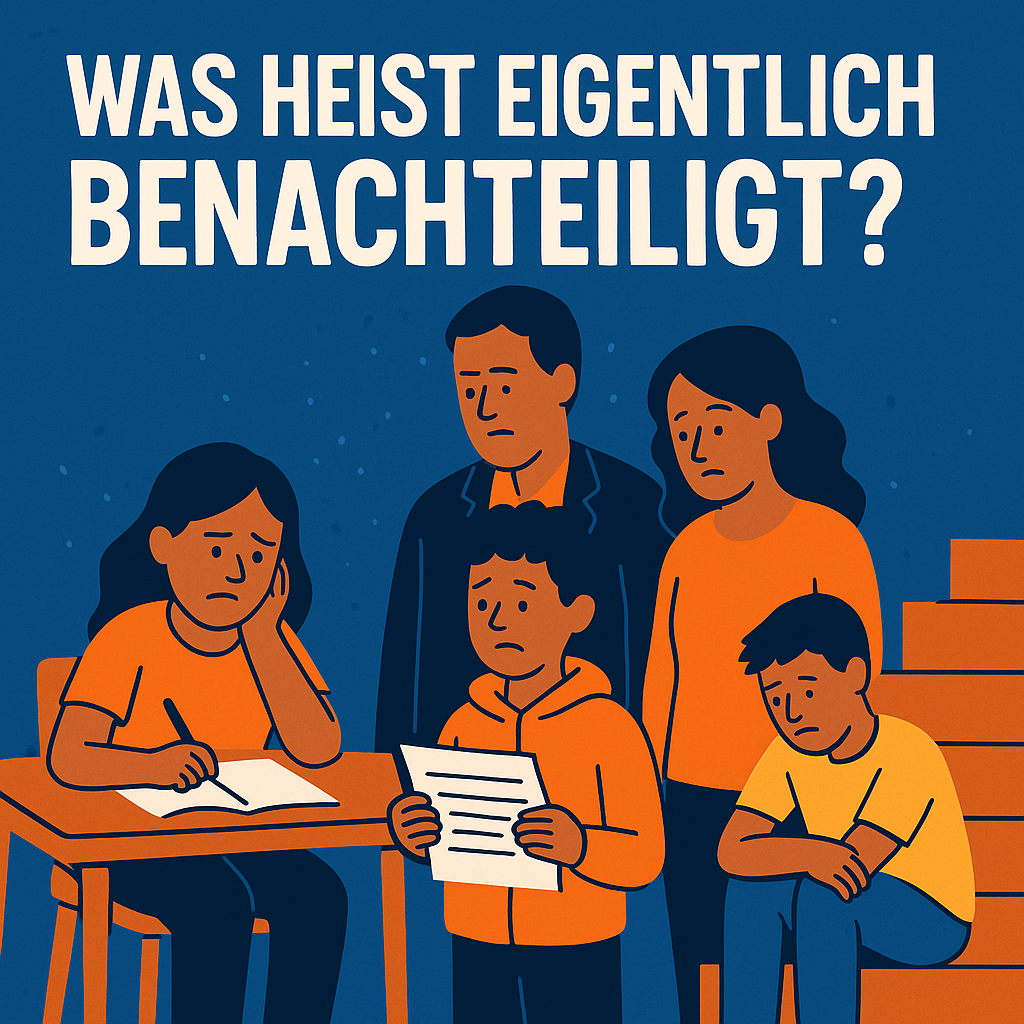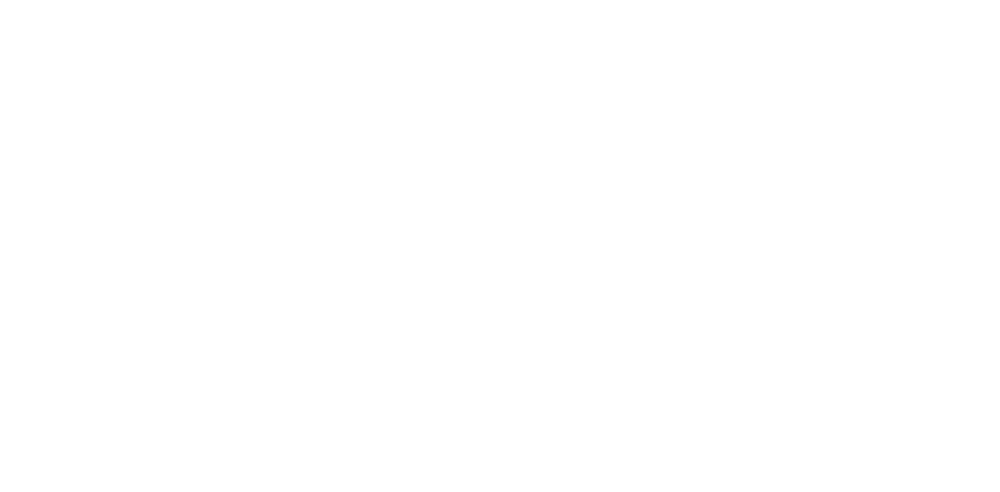Einleitung
Lehrkräfte gelten in der öffentlichen Wahrnehmung oft als resiliente Allrounder: engagiert, flexibel, krisenfest. Gleichzeitig zeigen zahlreiche Studien der letzten Jahre, dass der Lehrberuf zu den am stärksten belasteten Professionen im öffentlichen Dienst zählt. Das subjektive Beanspruchungserleben vieler Lehrpersonen ist geprägt von hohem emotionalem Druck, Zeitknappheit, Erwartungswidersprüchen und strukturellen Defiziten. In dieser Analyse werden zentrale Befunde aktueller Studien aus dem deutschsprachigen Raum zusammengefasst, um den vielschichtigen Belastungslagen von Lehrpersonen systematisch nachzugehen: mit besonderem Fokus auf die Ursachen dieser Überforderung.
1. Psychische Belastung und emotionale Erschöpfung
Laut dem Deutschen Schulbarometer 2024 (Robert Bosch Stiftung) geben über 30 % der befragten Lehrkräfte an, mehrmals pro Woche emotional erschöpft zu sein. Besonders betroffen sind jüngere Lehrpersonen, Frauen sowie Lehrkräfte an Grundschulen. Die Ursachen liegen laut Studie in:
- starker Heterogenität der Schüler*innenschaft,
- wachsender sozialer Verantwortung ohne adäquate Unterstützung,
- einem hohen Anteil an Schüler*innen mit psychischen Belastungen und
- einem Mangel an multiprofessionellen Teams.
Parallel zeigt eine Hamburger Erhebung der GEW (2024), dass rund 18 % der Lehrkräfte ein hohes Risiko für Depression oder Burnout aufweisen. Fast drei Viertel tragen ein moderates Risiko.
2. Arbeitszeit und fehlende Regeneration
Ergebnisse der Arbeitszeitstudie 2023 (Senatsverwaltung Berlin) und anderer Erhebungen zeigen:
- Zwei Drittel der Lehrkräfte überschreiten regelmäßig die 48-Stunden-Woche.
- Ein Drittel erreicht durchschnittlich über 50 Arbeitsstunden pro Woche.
- Insbesondere Korrekturphasen, Elterngespräche, Klassenorganisation und Dokumentation verursachen zusätzliche Arbeitslast.
Zugleich gelingt es laut BMC Public Health (2021) etwa 41 % der Lehrkräfte nicht, sich nach Dienstschluss mental von der Arbeit zu distanzieren. Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen (ca. 21 %) ist dies ein signifikant höherer Wert. Die Folge sind:
- Erhöhte Schlafstörungen
- Psychosomatische Beschwerden
- Dauerhafte Anspannung (emotionale Dissonanz)
Ursachenperspektive:
- Unklare oder nicht einlösbare Rollenerwartungen
- Fehlende zeitliche Abgrenzung zwischen Beruf und Privatleben
- Unverhältnismäßige Erwartung an individuelle Belastbarkeit
3. Gewalt und sozial-emotionale Anforderungen
Ein besonders belastender Faktor ist die Zunahme verbaler und physischer Übergriffe:
- 47 % der Lehrkräfte erleben regelmäßig Gewalt oder Bedrohung durch Schüler*innen (Bosch Stiftung, 2024).
- In sozialen Brennpunktlagen steigt dieser Wert auf bis zu 69 %.
Diese Erfahrungen sind nachweislich mit einer höheren Burnout-Wahrscheinlichkeit verbunden. Gleichzeitig fehlen an vielen Schulen angemessene Anlaufstellen für psychosoziale Unterstützung. Nur 20–30 % der Befragten geben an, dass es an ihrer Schule eine ausreichende Struktur dafür gibt.
Ursachenperspektive:
- Fehlende Präventionsprogramme und Handlungssicherheit bei Gewaltvorfällen
- Mangel an Schulsozialarbeit und psychologischer Begleitung
- Hoher Anteil von Schüler*innen mit komplexen sozialen Belastungslagen
4. Systemische Ursachen und strukturelle Engpässe
Lehrkräfte kompensieren vielfach strukturelle Leerstellen:
- Sie leisten informelle Sozialarbeit,
- koordinieren außerschulische Förderung,
- betreuen Kinder mit sprachlichen oder emotionalen Förderbedarfen,
- und organisieren digitalen Unterricht ohne ausreichende Schulung oder technische Infrastruktur.
Dies geschieht vielfach ohne zeitliche Entlastung, ohne personelle Verstärkung und ohne systemische Anerkennung.
Ursachenperspektive:
- Fehlende multiprofessionelle Teams an Grundschulen
- Starre Deputatsregelungen ohne Berücksichtigung zusätzlicher Belastung
- Projektlogik statt struktureller Verankerung von Unterstützungsangeboten
5. Schlussfolgerungen und Handlungsbedarf
Die Studienlage ist eindeutig:
- Die Überlastung vieler Lehrkräfte ist kein individuelles Problem, sondern Ausdruck systemischer Überforderung.
- Viele Belastungsfaktoren sind strukturell verankert und nicht durch individuelle Resilienz kompensierbar.
Handlungsempfehlungen:
| Bereich | Empfehlung |
|---|---|
| Arbeitszeit | Verbindliche Arbeitszeitregelung, realistische Deputate, bezahlter Ausgleich für Mehrarbeit |
| Schulstruktur | Aufstockung von multiprofessionellen Teams, Entlastung durch Fachpersonal (Sozialarbeit, IT, Schulpsychologie) |
| Gewaltprävention | Präventionsprogramme, verbindliche Meldeketten, rechtliche Stärkung von Lehrkräften |
| Erholung & Regeneration | Recht auf Nicht-Erreichbarkeit, Supervision, Fortbildungen zu Stressbewältigung |
| Haltung & Kultur | Wertschätzende Feedbackstrukturen, Sichtbarkeit von Beziehungsarbeit als Fachkompetenz |
Ausblick
Lehrkräfte sind zentrale Akteure für Bildungsgerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe. Um ihrer Rolle gerecht werden zu können, brauchen sie Schutz, Vertrauen, Zeit und Strukturen, die die psychische und physische Gesundheit ernst nehmen. Eine Reform der schulischen Rahmenbedingungen ist daher nicht nur eine Frage der Fairness gegenüber Lehrkräften, sondern eine Investition in die Bildungszukunft ganzer Generationen.